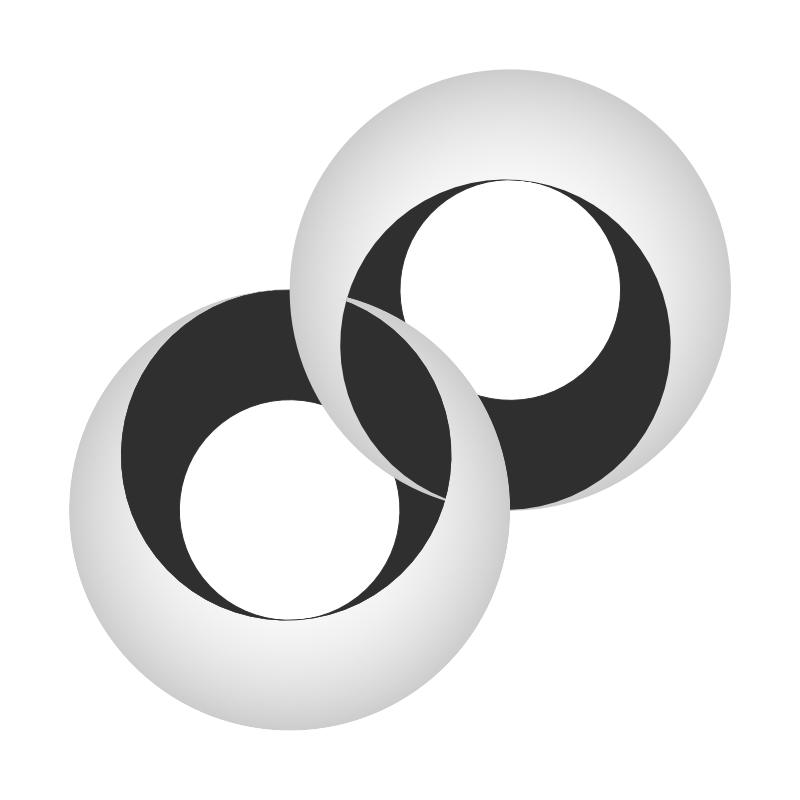Materielles Umweltrecht
Das sachliche Umweltrecht umfasst einzelne Schutzgüter zur Bewahrung der Lebensgrundlagen des Menschen sowie den Schutz von wild lebenden Lebewesen. Dies entspricht dem Schutzprinzip, welches auch im Verwaltungs-, Privat- und Strafrecht evident ist.
Das Vorsorgeprinzip zielt auf eine Art Risikomanagement für zukünftige nachteilige Entwicklungen ab, um Beeinträchtigungen zu reduzieren (Stand der Technik) oder latente Schäden zu eliminieren (Generationengerechtigkeit). Dies beinhaltet im Wesentlichen die summativen Effekte einer neuen Belastungsquelle zu einer bestehenden Grundbelastung.
Das Verursacherprinzip verpflichtet den Beeinträchtiger die Störung zu reparieren, jedoch nur insoweit, als keine Geringfügigkeitsgrenze (Feinstaub-, Lärmgrenzwerte, usw.) überschritten wird. Die Kollektivierung dieser schädlichen Lasten nennt man Gemeinlastprinzip.
Um nachfolgende Generationen ein Überleben zu sichern wurde das Nachhaltigkeitsprinzip von den United Nations (UN) definiert, ist jedoch in Österreich nur im Forstgesetz schon seit längerem verbindlich verankert.
Die relevantesten bundesweiten materiellen Regelungen bestehen aus
- Wasserschutzrecht (Wasserrechtsgesetz, …)
- Bodenschutzrecht (Forstgesetz, …)
- Klimaschutzrecht (Klimaschutzgesetz, …)
- Luftschutzrecht (Immissionsschutzgesetz, …)
In die Kompetenz der Bundesländer im jeweiligen Landesrecht fallen das
- Naturschutzrecht (Naturschutzgesetze, …)
- Bodenschutzrecht (Bodenschutzgesetze, …)
- Wildschutzrecht (Jagdgesetze, …)
Wesentliches Recht im Verfassungsrang bilden für unsere Zwecke das Staatsgrundgesetz, welches unter anderem den Gleichheitsgrundsatz, das Recht auf Freiheit und das Eigentumsrecht normiert, sowie andere Regelungen wie das Recht auf Leben (Menschenrechte) und Kinderrechte (BVG-Kinderrechte).
Formelles Umweltrecht
Die wichtigsten Verfahren im Umweltrecht sind die Strategische Umweltprüfung (SUP) im Verkehrsbereich (SP-V-G), das Umweltinformationsgesetz (UIG) und die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-G).
Das Subsidiaritätsprinzip des Föderalismus geht von einer Problemlösungshierarchie aus, um individuelle Freiheiten bestmöglich zu gewährleisten. Falls in der untersten Hierarchie (privatrechtliche Person oder Gemeinde) Konflikte nicht gelöst werden können, wird die Zuständige höhere Hierarchie (Gericht oder Gebietskörperschaft) angerufen. Dieser Bogen (Instanzenzug) kann sich von Landesverwaltungsgericht, Bundesverwaltungsgericht bis Verwaltungs- bzw. Verfassungsgerichtshof und weiter zum Europäischen Gerichtshof bis Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte oder das Welthandelsgericht der WTO spannen.
Gemäß der Aarhus-Konvention ist für jedermann die Öffentlichkeitsbeteiligung in der Strategischen Umweltprüfung sowie für Umweltinformationen gegeben. Für die Beteiligung an einem UVP-Verfahren ist der Status einer Umweltorganisation, einer Bürgerinitiative, eines betroffenen Nachbarn oder einer angrenzenden Gemeinde notwendig. Gegen die Bescheide der ausstellenden Behörde können Rechtsmittel ergriffen werden.
Aktivitäten von Verkehrswende.at
>>> weiterlesen unter Rechtsmittel
Weitere Informationen
SUP: https://www.strategischeumweltpruefung.at/
UIG: https://www.oesterreich.gv.at/themen/umwelt_und_klima/umweltinformation.html
Rechtssystem: https://richtervereinigung.at/justiz/rechtssystem/